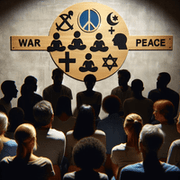Rassismuskritische Perspektiven auf Bildungsmedien
Stereotype in Lehrmaterialien erkennen
Was versteht man unter Rassismuskritik? Und was sind überhaupt Rassismus und Rassekonstruktionen? Wie spiegeln sie sich in Bildungsmedien wider? Welche neuen Einsichten kann eine rassismuskritische Perspektive auf Bildungsmedien im Unterschied zu multi- und interkulturellen Ansätzen hervorbringen? Auf diese und andere Fragen geht dieser Wissensbaustein ein.

Köln stellt sich quer – Protest gegen Rassismus im April 2017 (Foto: Raimond Spekking, 2017, Lizenz: CC BY-SA 4.0)
Was ist das? Definition
Zunächst stellt sich die Frage: Was ist Rassismuskritik und was kann ein rassismuskritischer Blick auf Bildungsmedien leisten? Rassismuskritik umfasst Haltung, Praktiken und Perspektiven, die sich gegen Rassismus richten. Aus Sicht der Bildungsmedienforschung bedeutet ein rassismuskritischer Blick auf die Inhalte von Schulbüchern und anderen Lehrwerken, darin verankerte, rassismusbezogene Ungleichheitsverhältnisse und Machtdynamiken aufzudecken und zu untersuchen. Denn Bildungsmedien sind keine neutralen Medien der Wissensvermittlung. Vielmehr kommunizieren sie bestimmte soziale Werte und Normen: So eröffnen sie einerseits die Möglichkeit, im Unterricht gesellschaftliche Vielfalt und Zusammenhalt im Sinne einer inklusiven und chancengerechten Bildung zu stärken. Andererseits können sie aber auch diskriminierende Vorstellungen reproduzieren, so auch Rassismus.
Woher kommt das? Geschichte
Rassismuskritische Perspektiven umfassen eine Vielzahl von Theorien und Handlungsstrategien, darunter multikulturelle und interkulturelle Ansätze, postkoloniale Theorien und Erkenntnisse sowohl aus der Kritischen Weißseinsforschung als auch aus Critical Race Theory (CRT). Letztere wurde in den USA zunächst im Bereich der Rechtswissenschaften entwickelt und ab Mitte der 1990er zunehmend auch für erziehungswissenschaftliche Diskurse erschlossen. So machte man für die Bildungsforschung damals die Beobachtung, dass nicht etwa zu wenig Untersuchungen zu rassismusbezogenen Phänomenen vorlägen, sondern dass die theoretische Fundierung bislang unzureichend sei (Ladson-Billings & Tate, 1995).
Ein wichtiger Impuls aus CRT besteht in der Erkenntnis, dass rassistische Ungleichheiten nicht auf individuellem Denken und Handeln beruhen, sondern das Ergebnis langzeitiger politischer Strategien und institutionalisierter Praktiken sind, die zielgerichtet auf die Erhaltung bestimmter Machtverhältnisse ausgelegt und auch heute noch in gesellschaftlichen Strukturen eingeschrieben sind (Bell 1992).
Damit setzt sich CRT von multikulturellen und interkulturellen Zugängen ab, die bis dahin bei der Auseinandersetzung mit Rassismus vorherrschend waren. Diese gingen von der Annahme unterschiedlicher, jeweils in sich geschlossener „Kulturen“ aus, zwischen denen vermittelt werden müsse (Niedrig & Ydesen 2011, S. 11-12; Pries & Maletzky 2018, S. 56). Auch die implizite Annahme, aus mehr kulturellem Wissen folge automatisch der Abbau von Vorurteilen auf individueller Ebene und mehr gesellschaftliche Toleranz auf kollektiver Ebene, wird aus rassismuskritischer Sicht in Zweifel gezogen. Zentralen Erkenntnissen aus CRT nach sollte auch sichtbar gemacht werden, welche Asymmetrien diese Zuschreibungen von Verschiedenheit produzieren.
Rassismuskritische Perspektiven reflektieren kritisch demnach sowohl die Konstruiertheit von gesellschaftlichen Differenzkategorien (Rassekonstruktion) wie auch bestehende Ungleichheitsverhältnisse als Folge dieser Differenzmarkierungen (Rassismus).
Wie erkennt man rassismusrelevante Inhalte in Bildungsmedien? Merkmale
Um rassismusrelevante Inhalte in Bildungsmedien umfassend und differenziert erkennen zu können, müssen zum einen explizite und implizite Rassekonstruktionen und zum anderen Angebote für die Lernenden zur Auseinandersetzung mit Rassismus betrachtet werden.
Kulturelle Vorurteile und Stereotype, wie sie in Bildungsmedien vorkommen, sind daher mit Rassekonstruktionen, also der Konstruktion unterschiedlicher und ungleichwertiger Menschengruppen, eng verknüpft. Zu solchen Rassekonstruktionen gehören:
- die Einteilung von Menschen in verschiedene Gruppen (Klassifizierung),
- die Gleichsetzung von Menschen innerhalb dieser Gruppen (Homogenisierung),
- die Zuschreibung vermeintlich gruppenbezogener Merkmale (Naturalisierung oder Kulturalisierung),
- die Festlegung dieser Merkmale als unveränderlicher Wesenskern dieser Gruppen (Essentialisierung),
- die Gegenüberstellung vermeintlich unvereinbarer Unterschiede zwischen den Gruppen (Polarisierung),
- der wertende Vergleich dieser Gruppen (Hierarchisierung).
„Rassismus“ hingegen baut auf Rassekonstruktionen auf: Er bezeichnet solche Machtverhältnisse, die sich auf die beschriebene Vorstellung unterschiedlicher Gruppen stützend die ungleiche Verteilung von Privilegien und Ressourcen legitimieren oder etablieren. Rassismus umfasst dabei sowohl Ideologien als auch Praktiken.
Wo kann man rassismusrelevante Inhalte in Bildungsmedien beobachten? Diskursfelder
Eine Auswertung von internationalen Forschungsarbeiten zu Rassismus in Schulbüchern zeigt, dass rassismusrelevante Inhalte in Zusammenhang mit einer Reihe von diskursiven Kontexten stehen:
- Migration: Studien mit Fokus auf Migration und migrationsbedingter gesellschaftlicher Diversität in Bildungsmedien weisen auf die häufig einseitige, lineare Diskussion von Migration hin (Hintermann et al. 2014; Weiner 2018), z.B. in das eigene Land, vom Globalen Süden in den Globalen Norden. Zudem werden Migrant*innen oft als Sonderfall mit Betonung von Fremdheit oder gar als Bedrohung dargestellt (Niehaus 2017; Budke & Hoogen 2018; Geuenich 2015; Grawan 2014).
- Minderheiten: Bei der Darstellung nationaler, ethnischer, kultureller oder religiöser Minderheiten fällt auf, dass viele Schulbücher eine ethnozentrische Sicht auf nationale Identität vertreten. Angehörige minorisierter Gruppen wie auch ihre historischen Beiträge werden marginalisiert. Dies kann von schlichter Abwesenheit bis zu diskriminierenden Stereotypen oder offenen Feindbildern reichen.
- Indigene Gruppen: Behandeln Schulbücher indigene Bevölkerungsgruppen, so beschränken sie sich in der Regel auf historische Ereignisse und vermitteln damit den Eindruck, sie gehörten einer kolonialen Vergangenheit an. Die heute gelebte Gegenwart, Kultur, Status und Rechte werden dagegen kaum erwähnt. Außerdem werden die kulturellen Errungenschaften indigener Völker oft gänzlich ausgespart oder eurozentrischen Narrativen untergeordnet.
- „The West and the Rest“: In Schulbüchern ist bisweilen eine implizite Gegenüberstellung von westlichen Ländern und dem "Rest" der Welt (vgl. Hall 1992) zu finden, nicht selten untermauert durch binäre Beschreibungsmuster, wie etwa Fortschritt vs. Rückständigkeit, die beispielweise in der geographischen Einteilung in Weltregionen und „Kulturräume“ sichtbar werden.
- Afrikabilder: Darstellungen des afrikanischen Kontinents und der dort lebenden Menschen sind teilweise durch hegemoniale Vorstellungen geprägt. Daneben werden machtbezogene Kontinuitäten zwischen kolonialer Unterdrückung und heutigen Ungleichheiten oftmals verschwiegen.
- Schwarze Menschen: Diskriminierende Stereotypen bei der Darstellung von afrikanisch-stämmigen, Schwarzen Menschen und Menschen mit dunkler Hautfarbe sind nicht selten. Studien zu Black History Textbooks zeigen aber auch positive Gegenbeispiele, wie mit einer Vielfalt von Identitätsangeboten und Counter-narratives dem entgegengewirkt werden kann (z.B. King & Simmons 2018).
- Weißsein: Schulbuchstudien, die sich auf Erkenntnisse der Kritischen Weißseinsforschung stützen, untersuchen, wie Weißsein, das heißt als „weiß“ markiertes Wissen und Perspektiven, zu allgemein gültigen Standards gemacht wird. Zudem ist zu beobachten, dass Personen mit hellem Hautton und/oder europäischem Erscheinungsbild in einzelnen Schulbüchern deutlich überrepräsentiert sind.
Was wird noch diskutiert? Ausblick
Eine rassismuskritische Perspektive kann allerdings auch Fallstricke mit sich bringen. Ein zu enger Fokus auf Rassismus läuft Gefahr, die vielfachen Zugehörigkeiten von Menschen aus den Augen zu verlieren. Man übersieht dann unter Umständen, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Rassismuserfahrungen machen, beispielsweise je nachdem, welcher sozialen Gruppe oder Geschlechtsidentität sie sich zugehörig fühlen bzw. welche ihnen zugeschrieben wird.
Daher ist es wichtig, dass eine rassismuskritische Perspektive auch Intersektionalität in den Blick nimmt, d.h. die Gleichzeitigkeit verschiedener Identitäten und deren komplexe Überschneidungen, die mit Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Diskriminierungsformen einhergehen können.
Wie sieht man das woanders? Internationaler Bezüge
Die Bekämpfung von Rassismus in und durch Bildung hat auch auf internationaler Ebene einen hohen Stellenwert. Die UNESCO engagiert sich sowohl gegen Rassismus als auch für die Qualität von Bildungsmedien. In den vergangenen Jahren veröffentlichte sie eine Reihe von anwendungsbezogenen Empfehlungen und Leitlinien, zuletzt Unmasking Racism. Guidelines for Educational Materials (2024).
Diese Leitlinien schaffen Bewusstsein dafür, in welcher Form sich Rassismus in Bildungsmedien weltweit manifestiert, und formuliert Empfehlungen aus rassismuskritischer Perspektive. Die Leitlinien geben Hilfestellung, wie Bildungsmedien nicht nur nicht-rassistisch werden, sondern auch eine anti-rassistische Ausrichtung bekommen können.
Verwandte Begriffe
Antirassismus, Bildung, Bildungsmedien, Black History, Critical Race Theory, Interkulturelle Bildung, Intersektionalität, Kritische Weißseinsforschung, Multikulturelle Bildung, Postkolonialismus, Schulbuch
Zur Reflexion
- Sichtbarkeit: Welche Identifikationsangebote werden für Lernende durch Bildungsmedien geschaffen? Überprüfen Sie in Ihrem Lehrwerke, wie beispielsweise Lernräume, Gruppen von Lernenden und andere Identifikationsfiguren in den Bildern dargestellt sind und was für Vor- und Nachnamen im Text ausgewählt werden. Außerdem: Wie werden Lernende durch Aufgabenstellungen angesprochen?
- Repräsentationen: Wie werden welche Personen und Personengruppen dargestellt? Überprüfen Sie im Lehrwerk, wer in welchen Positionen, Rollen, Berufen und bei welchen Tätigkeiten dargestellt wird. Welche Begriffe, Bilder und Beschreibungsmuster werden verwendet? Erkennen Sie Stereotype wieder und welche Assoziationen rufen die Darstellungen bei Ihnen hervor?
- Geschichtsnarrative: Wie werden Ereignisse durch Narrative strukturiert? Überprüfen Sie im Lehrwerk, wie kausale Verbindungen zwischen einzelnen Ereignissen hergestellt werden. Wie werden diese zu Haupt- und Nebenhandlungen arrangiert? Wie werden Beiträge einzelner Personen und ganze Bevölkerungsgruppen darin eingeordnet? Welche Geschichtsstränge und Perspektiven vermissen Sie?
Literaturliste
Fuchs, E. & Yu, S. (2024). Unmasking Racism. Guidelines for Educational Materials. Paris: UNESCO (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000388802?posInSet=1&queryId=db42681a-068a-40f9-8e3f-1835a7a88862)
Diese Leitlinien sind in Zusammenarbeit von UNESCO und dem Leibniz-Institut für Bildungsmedien | Georg-Eckert-Institut (GEI) in Braunschweig entstanden. Die Publikation enthält Empfehlungen zur Bekämpfung von Rassismus in Bildungsmedien und zur Förderung rassismuskritischen Verständnisses durch Bildungsmedien. Dazu werden erstens, wissenschaftliche Befunde aus internationalen Schulbuchuntersuchungen zusammengetragen und zweitens detaillierte Empfehlungen auf allgemeiner Ebene zu spezifischen Kontexten sowie zur Behandlung von Rassismus als Unterrichtsthema formuliert.
Yu, S. & Fuchs, E. (2023). Über Rassismus lernen (GEI Policy Brief 1/2023). Braunschweig: GEI (https://www.gei.de/wissenstransfer/policy-briefs).
Dieser GEI Policy Brief gibt einen kompakten Einblick darüber, wie Rassismus als Unterrichtsthema in Schulbüchern dargestellt wird, und präsentiert Empfehlungen für eine sowohl wissensbasierte als auch subjektorientierte Auseinandersetzung mit Rassismus. Der Policy Brief basiert auf dem Kapitel 2.3 Race and Racism as Subjects in Educational Materials innerhalb der UNESCO-Leitlinien Unmasking Racism.
Quellen
Bell, D. (1992). Racial Realism. Connecticut Law Review, 24 (2), 363-379. https://www.law.nyu.edu/sites/default/files/Racial%20Realism.pdf
Budke, A. & Hoogen, A. (2018). “Das Boot ist voll“: Wie Bilder in Geographieschulbüchern Vorstellungen von ‚illegalen‘ Migrantinnen und Migranten produzieren. In C. Rass & M. Ulz (Hrsg.), Migration ein Bild geben: visuelle Aushandlungen von Diversität (S. 129-160). Wiesbaden: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-10442-9_7
Geuenich, H. (2015). Migration und Migrant(inn)en im Schulbuch: Diskursanalysen nordrhein-westfälischer Politik- und Sozialkundebücher für die Sekundarstufe I. Wiesbaden: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-06688-8
Grawan, F. (2014). Impliziter Rassismus und kulturelle Hegemonie im Schulbuch? Rassismuskritische Analyse und objektivhermeneutische Rekonstruktion. Eckert. Working Papers 2014/2. Braunschweig: Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung. https://d-nb.info/1063752752/34
Hintermann, C., Markom, C., Weinhäupl, H. & Üllen, S. (2014). Debating migration in textbooks and classrooms in Austria. Journal of Educational Media, Memory, and Society, 6 (1), 79-106. https://doi.org/10.3167/jemms.2014.060105
Ladson-Billings, G. & Tate, W. F. (1995). Towards a critical race theory of education. Teachers College Record, 97 (1), 47-68. https://doi.org/10.1177/016146819509700104
Leonardo, Z. (2013). Race frameworks: a multidimensional theory of racism and education. New York: Teachers College.
Niedrig, H. & Ydesen, C. (2011). Writing Postcolonial Histories of Intercultural Education: An Introduction. In H. Niedrig & C. Ydesen, C. (Hrsg.), Writing postcolonial histories of intercultural education (S. 9-26). Frankfurt a. M.: Peter Lang.
Niehaus, I. (2017). „Formuliere mögliche Zukunftswege für ausländische Kinder“ – Migration und Integration im Schulbuch und die didaktisch‑pädagogische Adressierung von Schüler_innen. In S. Müller-Mathis & A. Wohnig (Hrsg.), Wie Schulbücher Rollen formen: Konstruktionen der ungleichen Partizipation in Schulbüchern (S. 106-123). Schwalbach/Ts.: Wochenschau Verlag.
Pries, L. & Maletzky, M. (2018). Interkulturalität, Multikulturalität, Transkulturalität. In I. Gogolin et al. (Hrsg.), Handbuch Interkulturelle Pädagogik (S. 55-60). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
Hall, S. (1992). The West and the Rest: Discourse and Power. In S. Hall & S. Gieben (Hrsg.), Formations of Modernity (S. 275-320). Cambridge, UK: Polity Press.
King, L. & Simmons, C. (2018). Narratives of Black History in Textbooks: Canada and the United States. In S. A. Metzger, S.A. & L. McArthur Harris (Hrsg.), The Wiley International Handbook of History Teaching and Learning (S. 93-116). Hoboken, NJ: Wiley Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781119100812.ch4
Weiner, M. F. (2018). Curricular alienation: multiculturalism, tolerance, and immigrants in Dutch primary school history textbooks. Humanity and Society, 42 (2), 147-170. https://doi.org/10.1177/0160597617716965
Bildquellen
Spekking, R. (2017). Köln stellt sich quer – Tanz die AfD [Fotografie]. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:K%C3%B6ln_stellt_sich_quer_-_Tanz_die_AfD-2791.jpg. CC BY-SA 4.0
„Rassismuskritische Perspektiven auf Bildungsmedien“ von Simiao Yu und Eckhardt Fuchs für wb-web (2025), CC BY-SA 4.0 DE.