Dr. Burkhard Lehmann Blog
Die Zukunft kommt von vorn
„Future Skills“ sind in der aktuellen Diskussion der Erwachsenen- und Weiterbildung omnipräsent. Mit ihnen sollen Lernende auf die zukünftigen Herausforderungen vorbereitet werden. In einem Gastbeitrag für wb-web beleuchtet Burkhard Lehmann kritisch die Herkunft der Future Skills und hinterfragt, ob sie dem an sie gelegten Anspruch gerecht werden können.
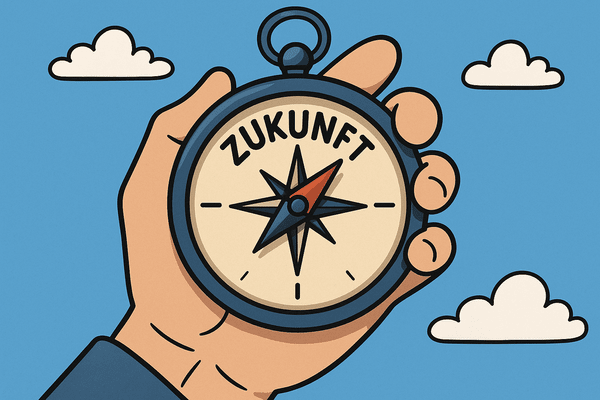
Gezielt in Richtung Zukunft navigieren: Wie wichtig sind hierfür Future Skills? (SORA, gemeinfrei).
Die Thematisierung von sogenannten „Future Skills“ ist von ausgeprägtem Alarmismus geprägt. Dieser besteht in der Sorge, dass die gesellschaftlichen Wandlungsprozesse, die in den letzten Jahren vor allem durch die Digitalisierung an Dynamik gewonnen haben, zu einem eklatanten Humankapitalproblem führen werden, wenn nicht rechtzeitig gegengesteuert wird. Diese Sorge wird u. a. von Ehlers (2020) geteilt. Er schreibt: „Kinder, die im nächsten Jahr in die Grundschule kommen, werden in zehn bis zwölf Jahren eine Berufsausbildung oder ein Studium beginnen und in fünfzehn Jahren als junge Berufstätige unsere Gesellschaft prägen. Über diese Zukunft wissen wir wenig. Im Jahr 2060–2065 werden sie aller Voraussicht nach ihre Erwerbstätigkeit beenden. Über diese Zukunft wissen wir nichts. Unsere Schulen müssen sie auf Jobs vorbereiten, die es heute noch nicht gibt, auf Technologien, Apps und Anwendungen, die heute noch nicht erfunden wurden, und darauf, in einer Gesellschaft zu leben, deren Strukturen wir heute nicht absehen können. Sie müssen auch darauf vorbereitet werden, mit Herausforderungen umzugehen, die heute noch nicht erkennbar sind“ (S. 2,). Auch wenn die Folgen der ungewissen Zukunft für verschiedene Sektoren wie Schulen, Unternehmen oder Hochschulen durchdekliniert werden, geht es im Kern um Employability, also den Erhalt der Ware Arbeitskraft als zentrale Komponente des Wertschöpfungsprozesses unter den Bedingungen gesellschaftlicher Transformation. Es ist daher kein Zufall, dass sich ausgerechnet der für seine neoliberale Agenda bekannte Stifterverband gemeinsam mit der Unternehmensberatung McKinsey dieser Thematik angenommen und eine Liste von Zukunftskompetenzen vorgestellt hat. Die Sorge um die künftige Employability von Arbeitnehmern wird dabei als Passungsproblem zwischen Ausbildungs- und Beschäftigungssystem interpretiert – wohl wissend, dass es sich hierbei stets um eine lose Koppelung handelt. Das gilt zumindest für einen erheblichen Teil der akademischen Bildung. Future Skills sollen das Heilmittel für die durch den Wandel hervorgerufenen Probleme der Beschäftigungsfähigkeit der Zukunft sein. Dass die in die Skills gesetzten Erwartungen eingelöst werden, ist jedoch fraglich. Dies liegt unter anderem daran, dass es sich bei Future Skills um einen „schillernden Begriff“ handelt (Ehlers 2020, S. 7) und unterschiedliche Bezeichnungen für die gleiche Sache verwendet werden. So ist beispielsweise von „21st Century Skills“, von „Zukunftskompetenzen“, dem „4K-Modell des Lernens“ oder von „Graduate Attributes“ die Rede. Nach einer gemeinsam geteilten Definition sucht man vergebens. Kotsiou et al. führen aus, dass Future Skills sich im Allgemeinen auf das Wissen, die Einstellungen, die Werte, die Fertigkeiten und die Kompetenzen beziehen, die die Lernenden darauf vorbereiten sollen, angesichts einer unsicheren Zukunft erfolgreich zu sein (vgl. Kotsiou et al. 2022, S. 174). Ehlers orientiert sich bei seiner Definition der Skills am Kompetenzbegriff von Erpenbeck (2010), der Beobachtungen aus der Physik zur Selbstorganisation zugrunde liegen. Ehlers definiert Future Skills als Kompetenzen, „die es Individuen erlauben, in hochemergenten Handlungskontexten selbstorganisiert komplexe Probleme zu lösen und (erfolgreich) handlungsfähig zu sein. Sie basieren auf kognitiven, motivationalen, volitionalen sowie sozialen Ressourcen, sind wertebasiert und können in einem Lernprozess erworben werden“ (Ehlers 2020, S. 57). Mit anderen Worten ausgedrückt bedeutet dies: Da niemand voraussagen kann, welche Kompetenzen in der Zukunft zur Bewältigung der kommenden Probleme benötigt wird, rücken anstelle der inhaltlichen Kompetenzen rein formale Kompetenzen in den Fokus, die diese Lücke schließen sollen. Der Eindruck liegt nahe, dass es um die Ausrüstung der Betroffenen mit einem Werkzeugkoffer von Fertigkeiten geht, mit deren Hilfe sich die Herausforderungen im „Do-it-yourself-Verfahren“ lösen lassen. An die Stelle des „Vorratslernens“ tritt die Selbstermächtigung der autonomen Persönlichkeit. Die Betonung der Selbstorganisation geht dabei mit einer Relativierung der Bedeutung von Fachwissen einher (Ehlers 2020, S. 18). Im Kompetenzdiskurs wird propagiert, dass Wissen keine Kompetenz ist (Arnold, Erpenbeck 2021). Daran kann sicher kein Zweifel bestehen. Unzweifelhaft ist aber ebenso, dass es ohne Wissen kein Können gibt. Zuständig für das Können ist vor allem das prozedurale Wissen, das jeder Form von Handlungsfähigkeit zugrunde liegt.
So wenig es eine allgemein gültige Definition von Future Skills gibt, so wenig ist klar, welche Kompetenzen konkret darunterfallen und wie viele Fertigkeiten es im Einzelnen sind, die fit für die Zukunft und ihre Herausforderungen machen sollen. In der einschlägigen Literatur kursiert eine ganze Reihe unterschiedlicher Kompetenzlisten. Ihre Erstellung basiert meist auf „Experten“-Befragungen, bei denen unter anderem die Delphi-Methode zum Einsatz kommt (OECD 2005, 2018, 2019; Meyer-Guckel et al. 2019; Stifterverband, McKinsey 2021; Ehlers 2020). Die Listen unterscheiden sich sowohl in ihrem Inhalt als auch in ihrem Umfang, d. h. der Anzahl der aufgezählten Kompetenzen. Eine theoretische Fundierung der Zukunftskompetenzen existiert nicht, abgesehen von den Bemühungen Ehlers (2020), diesen Mangel zu beheben.
Das Nebeneinander der verschiedenen Listen hat zu Synthetisierungsbemühungen geführt, die auf die Herausarbeitung von Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Aufzählungen abzielen (u. a. Ehlers 2020, Kotsiou et al. 2022, Pielorz 2025). Das Ergebnis ist, dass die Zahl der aufgelisteten Kompetenzen verringert wurde. Die auffälligste Gemeinsamkeit ist die Betonung digitaler Kompetenzen. Dass diese im Zeitalter der Digitalisierung relevant sein werden, dürfte kaum überraschen. Interessanterweise wird neben digitalen Kompetenzen auch Ambiguitätstoleranz eingefordert. Dabei handelt es sich um eine Grundqualifikation des Rollenhandelns, die Krappmann (1969) in seiner Theorie der Sozialisation als Ich-Identität herausgearbeitet hat. Er schreibt dazu: „Ein Individuum, das Ich-Identität behaupten will, muss auch widersprüchliche Rollenbeteiligungen und einander widerstrebende Motivationsstrukturen interpretierend nebeneinander dulden. Die Fähigkeit, dies bei sich und bei anderen, mit denen Interaktionsbeziehungen unterhalten werden, zu ertragen, ist Ambiguitätstoleranz. Sie eröffnet dem Individuum Möglichkeiten zur Interaktion und zur Artikulation einer Ich-Identität in ihr. Aber gleichzeitig ist Ambiguitätstoleranz auch wieder eine Folge gelungener Behauptung der Ich-Identität, weil sie dem Individuum die Erfahrung vermittelt, auch in sehr widersprüchlichen Situationen die Balance zwischen den verschiedenen Normen und Motiven halten zu können, und dadurch Ängste mindert“ (Krappmann 1969, S. 155). Die Fähigkeit zur Ambiguitätstoleranz scheint weniger eine Zukunftsfähigkeit als vielmehr Ausdruck einer reifen Persönlichkeit zu sein, die ihre Sozialisation erfolgreich durchlaufen hat.
Ein eklatanter Mangel der Future Skills ist, dass ihre Wirksamkeit zwar behauptet, aber keinesfalls erwiesen ist. Es fehlt jegliche empirische Evidenz (vgl. Reimann 2023). Die ihnen zugeschriebene Wirkung müssen sie erst noch unter Beweis stellen. Damit geht auch die Frage einher, auf welche Weise die Kompetenzen erworben werden sollen. Soll dies auf additive oder integrative Weise erfolgen? Bei den Schlüsselqualifikationen hat sich gezeigt, dass diese zumeist additiv vermittelt werden. Das bedeutet, dass es neben der Vermittlung von Lehr- und Lerninhalten Kursangebote gibt, die beispielsweise Kommunikationskompetenz oder Konfliktfähigkeit vermitteln.
Sollten sich die Future-Skills trotz aller Bedenken durchsetzen, darf man davon ausgehen, dass ein neuer Kursmarkt entsteht. Es ist zu erwarten, dass Bildungsanbieter Future Skills in ihre Programmangebote aufnehmen und als Investition in die Zukunft verkaufen werden. Hilfreich an der Debatte um die Zukunftskompetenzen könnte sein, dass sie einen Anstoß zur Überarbeitung und Renovierung bestehender Curricula geben und diese zukunftsfähig machen. Ein eigenes Skill-Training braucht man dafür nicht.
Zur Person
Dr. Burkhard Lehmann war langjähriger Geschäftsführer des Zentrums für Fernstudien und Universitäre Weiterbildung an der Universität Koblenz, Leiter der Stabsstelle Kommunikation und Marketing an der FernUniversität Hagen und Geschäftsführer des Distance and International Studies Center der TU Kaiserslautern. Er studierte Erziehungswissenschaften, Psychologie und Soziologie an der Universität Münster.
"Die Zukunft kommt von vorn" by Burkhard Lehmann für wb-web (2025) CC BY-SA 3.0 DE
Quellen
Arnold, R., Erpenbeck, J. (2021). Wissen ist keine Kompetenz. Dialoge zur Kompetenzreife. Baltmannsweiler. Schneider Verlag. 5. Auflage.
Ehlers, U. D. (2020). Future Skills. Lernen der Zukunft – Hochschule der Zukunft. Wiesbaden, Springer.
Erpenbeck, J. (2010). Kompetenzen – eine begriffliche Klärung. In: V. Heyse, J. Erpenbeck,S. Ortmann (Hrsg.): Grundstrukturen menschlicher Kompetenzen. Praxiserprobte Konzepte und Instrumente. Münster 2010.
Kotsiou, A., Fajardo-Tovar, D.D., Cowhitt, T., Major, L., Wegegrif, R. (2022). A scoping review of Future Skills frameworks. In: Irish Educational Studies, 41, 1, S. 171-186.
Meyer-Guckel, V., Klier, J., Kirchherr, J., & Winde, M. (2019). Future Skills: Strategische Potenziale für Hochschulen. Future Skills Diskussionspapier 3. Berlin: Stifterverband. Verfügbar online: https://www.stifterverband.org/download/file/fid/7213.
Kaltz, M. (2023). Zurück in Die Zukunft? Eine Literaturbasierte Kritik Der Zukunftskompetenzen“. Medien Pädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung 2023 (Occasional Papers):332-52.
Krappmann, L. (1969). Soziologische Dimensionen der Identität. Strukturelle Bedingungen für die Teilnahme an Interaktionsprozessen. Stuttgart: Klett, 1. Aufl. 1971.
OECD (2005). The Definition and Selection of Key Competencies: Executive Summary. OECD. Zuletzt aufgerufen am 18.8.2025. https://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf.
OECD (2018). The Future of Education and Skills: Education 2030. OECD. Zuletzt aufgerufen am 18.8.2025 https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/about/projects/edu/education-2040/position-paper/PositionPaper.pdf.
OECD (2019). OECD Future of Education and Skills 2030. OECD. Zuletzt aufgerufen am 18.8.2025 https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/about/projects/edu/education-2040/1-1-learning-compass/OECD_Learning_Compass_2030_Concept_Note_Series.pdf
Pielorz, M. (2025). Mit Kompetenzen in die Zukunft. weiter bilden. DIE Zeitschrift für Erwachsenenbildung 32 (1), 52–56. https://www.die-bonn.de/doks/weiterbilden/2025/pielorz.pdf.
Reimann, G. (2023). Kein System, keine Evidenz. Zuletzt aufgerufen am 24.06.2023: https://gabi-reinmann.de/kein-system-keine-evidenz/.
Stifterverband, Mc Kinsey u. Company (2021). Future Skills 2021. 21 Kompetenzen für eine Welt im Wandel. Zuletzt aufgerufen am 23.06.2023. https://www.stifterverband.org/download/file/fid/10547.
UNESCO (2019). Futures Literacy: An Essential Competency for the 21st Century. UNESCO. Zuletzt aufgerufen am 24.06.2023. https://en.unesco.org/futuresliteracy/about.


